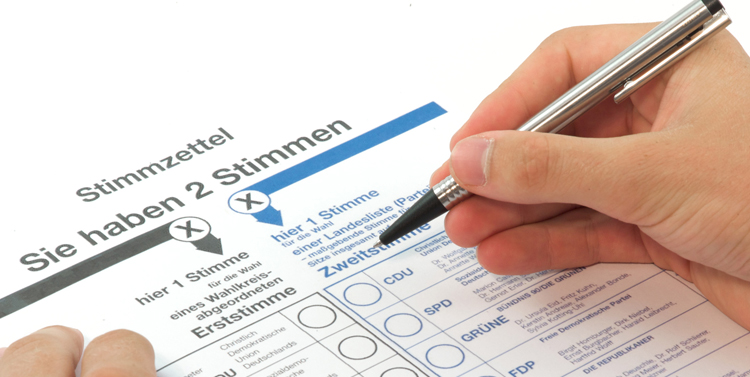Wer kann sich einbürgern lassen?
Wenn Sie dauerhaft in Deutschland leben, aber noch nicht deutscher Staatsangehöriger sind, können Sie sich einbürgern lassen. Das geschieht nicht automatisch, sondern nur auf Antrag. Von den genannten Voraussetzungen gibt es Ausnahmen und es bestehen Sonderregelungen. Auskünfte dazu erteilen die zuständigen Verwaltungsbehörden. Es wird in jedem Falle empfohlen, sich vor einer Antragstellung dort beraten zu lassen.
Einen Anspruch auf Einbürgerung hat in der Regel, wer alle folgenden Voraussetzungen erfüllt, wer …
…seit fünf Jahren rechtmäßig den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat.
Diese Voraussetzung erfüllt, wer sich grundsätzlich ununterbrochen fünf Jahre rechtmäßig in Deutschland aufhält, und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine auf Dauer angelegte Aufenthaltserlaubnisbesitzt.
Über Besonderheiten und Ausnahmen von den Regelvoraussetzungen beraten die zuständigen Verwaltungsbehörden.
…die Regeln und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland akzeptiert und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt.
Wer über 16 Jahre alt ist, muss sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung für die Bundesrepublik Deutschland bekennen.
Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren müssen die Eltern den Antrag auf Einbürgerung stellen.
Jugendliche, die sich ab dem 16. Lebensjahr einbürgern lassen möchten, durchlaufen dann das gleiche Verfahren wie Erwachsene und müssen sich bereits bei der Antragsstellung schriftlich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung für die Bundesrepublik Deutschland bekennen. Außerdem muss schriftlich eine Loyalitätserklärung und ein Bekenntnis zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen abgegeben werden.
Außerdem muss bei der Einbürgerung erklärt werden, dass keine Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verfolgt oder unterstützt werden oder dies in der Vergangenheit getan wurde. Vor der Übergabe Ihrer Einbürgerungsurkunde muss das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung schriftlich abgeben werden. Das Bekenntnis wird während der feierlichen Übergabe der Einbürgerungsurkunde ein weiteres Mal mündlich wiederholt.
In § 10 Abs. 1 Satz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) ist diese Voraussetzung festgelegt. Das Bekenntnis erfolgt durch die unterschriebene Loyalitätserklärung.
Schon während des Einbürgerungsverfahrens führen Mitarbeitende der zuständigen Behörde mit Ihnen Gespräche über die Grundordnung und die Grundwerte Deutschlands. Dabei geht es um:
- Demokratie und Volkssouveränität
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird durch Abstimmungen, allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen und durch besondere Organe der Gesetzgebung (Parlamente), der Rechtsprechung (Gerichte) und Verwaltung (Behörden) ausgeübt. - Rechtsstaatlichkeit
Die Parlamente sind an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden, Gerichte und Behörden an Recht und Gesetz. - Recht auf eine parlamentarische Opposition
Die in den Parlamenten vertretenen Parteien, die nicht an der Regierung beteiligt sind, stellen die Opposition dar; sie bildet das politische Gegengewicht zur Regierung und hat die Aufgabe, sie zu kontrollieren. - Verantwortlichkeit und Ablösbarkeit der Regierung
Die Regierung ist dem Parlament für ihre Tätigkeit rechenschaftspflichtig und verantwortlich; sie kann durch das Parlament abgelöst werden. - Unabhängigkeit der Gerichte
Die Gerichte sind unabhängig. Sie können von Regierungen oder Parlamenten nicht kontrolliert werden. Die Richterinnen und Richter sind nur dem Gesetz und ihrem Gewissen bei der Rechtsanwendung verpflichtet. - Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft
Gewalt und Willkür sind der freiheitlichen demokratischen Grundordnung fremd. Dort, wo ausnahmsweise Gewalt angewendet werden muss, ist dies durch ausdrückliche gesetzliche Regelungen unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips angeordnet und staatlichen Organen vorbehalten. - Menschenrechte, wie sie im Grundgesetz und der Verfassung des Landes Hessen konkretisiert sind.
Die Achtung vor den Menschenrechten ist ein Stützpfeiler der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Dazu gehört vor allem das Recht der Persönlichkeit auf Leben und Entfaltung.
Antisemitische, rassistische oder sonstige menschenverachtende Handlungen sind mit der Menschenwürde, die das Grundgesetz allen garantiert, nicht vereinbar. Solche Handlungen verstoßen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung.
Über Besonderheiten und Ausnahmen von den Regelvoraussetzungen beraten die zuständigen Verwaltungsbehörden.
- Demokratie und Volkssouveränität
…sich zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands bekennt.
Wer das 16. Lebensjahr vollendet hat, muss sich, um eingebürgert zu werden, zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen bekennen, insbesondere zum Schutz jüdischen Lebens, zum friedlichen Zusammenleben der Völker und zum Verbot der Führung eines Angriffskrieges.
Die deutsche Staatsangehörigkeit erhält nicht, wer Handlungen begeht, mit denen gegen dieses Bekenntnis verstoßen wird.
…ein unbefristetes oder eine auf Dauer angelegte Aufenthaltserlaubnis hat.
Die Voraussetzung eines unbefristeten oder eines auf Dauer angelegten Aufenthaltsrecht erfüllt:
- Wer eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt in der EU besitzt.
- Wer als EU-Bürgerin oder EU-Bürger oder als deren Familienangehörige oder Familienangehöriger freizügigkeitsberechtigt ist. Es wird dann kein Aufenthaltstitel benötigt, sondern nur ein gültiger Personalausweis. Familienangehörige benötigen die sogenannte „Aufenthaltskarte“ für Familienangehörige von EU-Bürgerinnen oder EU-Bürgern. Diese erhält man nach Einreise in Deutschland von der Ausländerbehörde.
- Wer Staatsangehörender von Island, Liechtenstein oder Norwegen ist. Damit sind Sie EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern gleichgestellt.
- Wer ein Aufenthaltsrecht nach dem Austrittsabkommen der EU mit Großbritannien oder nach dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU besitzt.
- Wer als türkische Arbeitnehmende oder als Familienangehörende ein Aufenthaltsrecht aufgrund des Assoziationsabkommens der Europäischen Union mit der Türkei hat.
Auch eine befristete Aufenthaltserlaubnis kann für die Einbürgerung ausreichen, wenn sie zu einem Zweck erteilt wurde, der grundsätzlich den dauerhaften Aufenthalt in Deutschland ermöglichen soll. Das ist grundsätzlich der Fall, wer zum Beispiel als Fachkraft in Deutschland arbeitet oder wenn die Aufenthaltserlaubnis für einen Familiennachzug erteilt wurde.
Eine befristete Aufenthaltserlaubnis reicht nicht für eine Einbürgerung für Personen, die zum Studium, zur Ausbildung oder für bestimmte Aufenthalte aus humanitären Gründen in Deutschland sind.
Nicht ausreichend ist eine Aufenthaltsgestattung oder Duldung zum Zeitpunkt der Einbürgerung.
Über Besonderheiten und Ausnahmen von den Regelvoraussetzungen beraten die zuständigen Verwaltungsbehörden.
…über eine geklärte Identität und Staatsangehörigkeit verfügt.
Für die Einbürgerung müssen Identität und Staatsangehörigkeit geklärt sein. Dafür müssen Sie Angaben zu Ihrer Identität und Staatsangehörigkeit machen und diese nachweisen können, beispielsweise durch die Vorlage eines amtlichen Identitätsdokuments (z.B. Reisepass) oder durch Vorlage geeigneter amtlicher Urkunden.
Es können ausnahmsweise auch andere Identitätsnachweise in Betracht kommen.
Über Besonderheiten und Ausnahmen von den Regelvoraussetzungen beraten die zuständigen Verwaltungsbehörden.
… über Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland verfügt.
Die für eine Einbürgerung erforderlichen Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland werden in der Regel durch einen Einbürgerungstest oder im Rahmen eines Integrationskurses mit dem Test „Leben in Deutschland“ nachgewiesen. Beide Tests haben den gleichen Fragenkatalog, welcher 310 Fragen beinhaltet und wovon 33 Fragen beim Test beantwortet werden müssen. Wer mindestens 17 Fragen richtig beantwortet, hat den Test bestanden.
Wer 16 Jahre oder älter ist, muss den Test ablegen und bestehen.
In den letzten Jahren haben weit über 90 % der Teilnehmenden den Test bestanden.
Wer einen deutschen Schul- oder Studienabschluss hat, muss den Test in der Regel nicht ablegen. Auch wenn Sie als Gastarbeitende bis zum 30. Juni 1974 in die Bundesrepublik Deutschland bzw. als Vertragsarbeitende bis zum 13. Juni 1990 in die Deutsche Demokratische Republik (DDR) eingereist sind, müssen Sie den Test nicht absolvieren. Diese Ausnahme gilt auch für Ehepartnerin oder Ehepartner, wenn diese im zeitlichen Zusammenhang nachgezogenen sind. Weitere Ausnahmen gibt es, wenn der Test zum Beispiel aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder altersbedingt nicht abgelegt werden kann.
Über Besonderheiten und Ausnahmen von den Regelvoraussetzungen beraten die zuständigen Verwaltungsbehörden.
… den Lebensunterhalt für sich und weitere unterhaltsberechtigte Familienangehörige durch eigenes Einkommen oder Vermögen ohne Hilfe vom Staat alleine decken kann und keine Hilfe zum Lebensunterhalt erhält.
Ein zentraler Aspekt der Einbürgerung in Deutschland ist die Sicherung des Lebensunterhalts. Die Sicherung des Lebensunterhalts ist eine der Grundvoraussetzungen für die Einbürgerung nach § 10 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) und bedeutet, dass wer die Notwendigkeiten des täglichen Lebens und der eigenen Familie durch eigenes Einkommen oder Vermögen ohne Hilfe vom Staat alleine decken kann und keine Hilfe zum Lebensunterhalt erhält. Hierzu zählen unter anderem:
- Gehaltszahlungen aus einer Erwerbstätigkeit
- Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit
- Rentenbezüge oder ähnliche Einkünfte.
Sie dürfen in der Regel keine Leistungen vom Jobcenter oder vom Sozialamt erhalten.Zu diesen gehören:
- Arbeitslosengeld II
- Sozialhilfe
- Bürgergeld
- Leistungen nach SGB II oder SGB XII (Sozialgesetzbuch)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Leistungen vom Jobcenter
Grundsätzlich keinen Einfluss auf Ihren Anspruch auf Einbürgerung hat es, wenn Sie beispielsweise eine der folgenden Leistungen erhalten:
- Kindergeld
- Rente zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- BAföG
- Wohngeld
- Leistungen der Kinder und Jugendhilfe nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch
- Erziehungs- und Elterngeld
- Renten aus der Sozialversicherung
- Krankengeld
- Arbeitslosengeld
- Ausbildungsförderung und Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz
Die Behörde überprüft, ob Sie dauerhaft in der Lage sein werden, Ihren Lebensunterhalt und den Ihrer unterhaltsberechtigten Familienangehörigen aus eigenen Einkünften zu sichern. Bei der Einschätzung berücksichtigt die Behörde Ihre Berufschancen, Ihre Erwerbsbiografie und Ihre aktuelle Einkommenssituation. Für die Prüfung kann die Behörde Einkommensnachweise, Rentenversicherungsverläufe oder auch Einkommenssteuerbescheide (bei Selbstständigen) anfordern.
Über Besonderheiten und Ausnahmen von den Regelvoraussetzungen beraten die zuständigen Verwaltungsbehörden.
...über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt.
Grundsätzlich werden ausreichende Sprachkenntnisse benötigt, also das Sprachniveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.
Wenn Sie erfolgreich an einem Integrationskurs teilgenommen haben oder zum Beispiel in Deutschland einen Schul- oder Studienabschluss erlangten, geht die Behörde für gewöhnlich davon aus, dass Sie ausreichend Deutsch sprechen.
In folgenden Ausnahmefällen ist eine Einbürgerung auch ohne den Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Sprachniveau B1 möglich:
- Wenn Sie als Gastarbeitende bis zum 30. Juni 1974 in die Bundesrepublik Deutschland oder als Vertragsarbeitende bis zum 13. Juni 1990 in die Deutsche Demokratische Republik (DDR) eingereist sind, reicht es aus, wenn Sie sich im Alltag in deutscher Sprache mündlich verständigen können und dies der Behörde auch nachweisen können. Diese Ausnahme gilt auch für Ihre Ehepartnerin oder Ihren Ehepartner, wenn sie oder er im zeitlichen Zusammenhang nachgezogenen ist.
- wenn Sie die Kenntnisse wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder altersbedingt nicht erwerben können.
- wenn es Ihnen trotz nachhaltiger Bemühungen nicht möglich ist oder dauerhaft wesentlich erschwert ist, die Sprachkenntnisse zu erwerben. Die Staatsangehörigkeitsbehörde stellt einen Härtefall fest. Dazu muss nachgewiesen werden, dass es aufgrund der Lebenssituation nicht zu schaffen ist, Deutsch auf dem Niveau B 1 zu lernen, zum Beispiel weil ein Angehöriger dauerhaft pflegebedürftig ist. Sie müssen sich ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache mündlich verständigen können.
Die Staatsangehörigkeitsbehörde prüft im Einzelfall, ob eine Ausnahme vorliegt.
Über Besonderheiten und Ausnahmen von den Regelvoraussetzungen beraten die zuständigen Verwaltungsbehörden.
...nicht wegen einer Straftat verurteilt ist.
Eine Verurteilung wegen einer schwereren Straftat macht die Einbürgerung unmöglich. Das gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch für Verurteilungen im Ausland. Nach gewissen Fristen – je nach Schwere der Tat – werden solche Straftaten aber wieder aus dem Strafregister (Bundeszentralregister) gestrichen. Nach Ablauf dieser Fristen ist eine Einbürgerung wieder möglich.
Geringfügige Verurteilungen stehen der Einbürgerung grundsätzlich nicht im Wege. Dazu zählen Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel nach dem Jugendgerichtsgesetz, Geldstrafen von bis zu 90 Tagessätzen oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Monaten, wenn sie zur Bewährung ausgesetzt wurden und die Strafe nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen wurde. Mehrere Geld- oder Freiheitsstrafen werden grundsätzlich zusammengezählt.
- Links & Downloads
Mehr Informationen zur Hessischen Integrationspolitik finden Sie im Integrationskompass